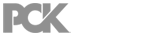Schauspiel
Elling
Schauspiel von Axel Hellstenius (unter Mitwirkung von Petter Næss) nach dem Roman „Blutsbrüder“ von Ingvar Ambjørnsen, Übersetzt aus dem Norwegischen von Gabriele Haefs
Elling über Elling
Von größeren Versammlungen wird mir immer schlecht. Ich mag Menschen, möchte aber lieber eine gewisse Distanz halten. Sie zum Beispiel vom Fenster aus sehen. Im Grunde ist das ganz einfach: Ich finde es nun mal unmöglich, eine enge Beziehung, eine Vertrauensbeziehung zu einer Menschenmenge zu haben. Und ich glaube Leuten nicht, die behaupten, sie hätten eine. Die lügen. Vertrauen kann man zu einem Menschen haben, vielleicht noch zu zweien. Die Masse wird zu einer Mauer aus Fleisch und verworrenen Absichten. Die Masse ist das Unberechenbare. Das vielköpfige Ungeheuer, das uns am Palmsonntag zujubelt und uns am nächsten Freitag ans Kreuz schlägt. Deshalb war ich, als Gunn mich als „Elling – unser Neuer“ vorstellte, auf das Schlimmste vorbereitet. Ich hatte schließlich gesehen, wie zu Hause auf dem Schulhof neue Schüler behandelt worden waren.
(Blutsbrüder, S. 18f.)
Ich bin nicht unzugänglich, aber meine Freundschaft gibt es nicht im Sonderangebot. Ich teile mich nicht mit jedem. Ein Mann ohne Stolz ist ein Mann ohne festen Boden unter den Füßen. So einfach ist das. Mit welchem Recht sind sie in mein Leben eingebrochen? Ich fragte ja nur. Und die Antwort, die flattert im Wind umher, um mit einem pensionierten Protestsänger zu sprechen. Meine Alben mit den Zeitungsausschnitten über Gro Harlem Brundtland hatten sie beschlagnahmt. Vermutlich waren sie schon längst vernichtet. Nun gut. Einen echten Elling kann man auf diese Weise nicht brechen. Sie verboten mir, über sie zu sprechen. Gut. Also schwieg ich. Es paßte mir ganz ausgezeichnet, über fast alles zu schweigen.
(Blutsbrüder, S. 10)
Hundert Jahre vor meiner Zeit malte Edvard Munch ein Bild namens „Abend auf Karl Johan“. Ich weiß noch, daß dieses Bild in irgendeinem Schulbuch abgebildet war. Und daß es mich schon damals tief beeindruckt hat. Es zeigt viele Menschen, die in Richtung Schloß über Karl Johan strömen. Ihre Gesichter sind bleich, fast grünlich, ihre Augen groß und leer. Sie scheinen gerade erst aus dem Grab auferstanden zu sein. Und über die leere Fahrbahn geht, genau in Gegenrichtung zu allen anderen, eine dunkel gekleidete Gestalt. Wie bei so vielen Bildern von Munch beschleicht mich ein Gefühl der Einsamkeit, wenn ich es mir ansehe, es macht mir fast schon Bauchweh. Ich glaube, das war meine erste Begegnung mit Munchs Welt, und deshalb hat dieser Anblick mich vielleicht so erschüttert. Bis dahin hatte ich Gemälde für etwas gehalten, das man sich zur Dekoration an die Wand hängt. Daß sie etwas mit uns machen können, hatte ich einfach nicht gewußt. Aber auf seltsame Weise erkannte ich mich in diesem Bild wieder. Ich wußte, daß ich dort über die Straße ging, weg von allen anderen, vom Hauptstrom. Mir saß diese Stimmung gewissermaßen unter der Haut. Natürlich wurden in meiner Klasse Witze über dieses Bild gerissen. Die Scherzkekse zogen sich an Munchs Farbgebung hoch und wiesen darauf hin, daß die Menschen in Wirklichkeit nicht so aussehen. Viele Jahre später, als ich auf den Kulturseiten von Arbeiderbladet einen Artikel über Munch las, stellte sich heraus, daß Munchs Zeitgenossen auch nicht anders reagiert hatten. Ich hätte weinen mögen, als ich das las, denn mir ging dabei auf, wie einsam er gewesen sein mußte. In dem Artikel standen auch Auszüge aus den Tagebüchern des Malers. Einer behandelte das erwähnte Bild „Abend auf Karl Johan“. Munch schreibt von einer soeben beendeten unglücklichen Liebesaffäre. Einsam und verlassen läßt er sich durch die Straßen treiben, weg von der Gemeinschaft. Er schreibt, daß es um ihn herum plötzlich so still wird. Die Wirklichkeit scheint sich aufzulösen, und bleiche Gesichter starren ihn an. Mit diesen Worten und mit dem Bild beschrieb er das, was ich selbst nicht in Worte fassen konnte, was ich aber so oft empfand. Ich bewegte mich zwischen anderen Kulissen, das schon. Aber mein Erleben der Wirklichkeit kam dem des großen Künstlers verblüffend nahe. Mich konnte es überfallen, wenn ich auf dem Weg zum Laden war, Mutters Einkaufskarre in der einen und den Einkaufszettel in der anderen Hand. Stille senkte sich um mich herum, und die Gesichter der Menschen auf den Gehwegen zwischen den Blocks verzerrten sich. Ich hatte den Eindruck, daß sie mir übelwollten, daß sie es auf irgendeine Weise auf mich abgesehen hatten. Und ich kann ja auch nicht leugnen, daß genau das oft der Fall war, wir hatten zum Beispiel eine gemeine Bande von Jungen, die um das Einkaufszentrum herumlungerten und schrecklich gern meinen Kopf in Mutters Einkaufskarre preßten. Aber auch sonst, wenn keine Gefahr drohte, glitt ich aus dem Zusammenhang heraus und war vor Angst wie gelähmt. Es kam auch vor, daß ich ganz einfach an meiner Existenz zweifelte. Oder, genauer gesagt, daß ich das Gefühl hatte zu verschwinden. Mich aufzulösen. In solchen Fällen kam es vor, daß ich versuchte, mir etwas anzutun. Das heißt, das glaubten die Außenstehenden. Nicht einmal meine eigene Mutter konnte begreifen, daß ich mich mit Eschenzweigen peitschte oder mir mit der flachen Hand ins Gesicht schlug, um wieder Kontakt zu mir selber zu finden. Und ich konnte das auch nicht vernünftig erklären. Ich brachte nur Schluchzen und abgehackte Wortfetzen zustande.
(Blutsbrüder, S. 41ff.)
In meiner Jugend hatte ich mit genug Psychologen gesprochen. Mehr war dazu nicht zu sagen. Auch als Junge hatte ich schon nicht viel auf dem Herzen gehabt, aber jetzt war alles blank. Ich konnte diese Aufmerksamkeit eines für mich wildfremden Mannes mit einem Examen in Psychologie einfach nicht begreifen.
(Blutsbrüder, S. 47)
Von größeren Versammlungen wird mir immer schlecht. Ich mag Menschen, möchte aber lieber eine gewisse Distanz halten. Sie zum Beispiel vom Fenster aus sehen. Im Grunde ist das ganz einfach: Ich finde es nun mal unmöglich, eine enge Beziehung, eine Vertrauensbeziehung zu einer Menschenmenge zu haben. Und ich glaube Leuten nicht, die behaupten, sie hätten eine. Die lügen. Vertrauen kann man zu einem Menschen haben, vielleicht noch zu zweien. Die Masse wird zu einer Mauer aus Fleisch und verworrenen Absichten. Die Masse ist das Unberechenbare. Das vielköpfige Ungeheuer, das uns am Palmsonntag zujubelt und uns am nächsten Freitag ans Kreuz schlägt. Deshalb war ich, als Gunn mich als „Elling – unser Neuer“ vorstellte, auf das Schlimmste vorbereitet. Ich hatte schließlich gesehen, wie zu Hause auf dem Schulhof neue Schüler behandelt worden waren.
(Blutsbrüder, S. 18f.)
Ich bin nicht unzugänglich, aber meine Freundschaft gibt es nicht im Sonderangebot. Ich teile mich nicht mit jedem. Ein Mann ohne Stolz ist ein Mann ohne festen Boden unter den Füßen. So einfach ist das. Mit welchem Recht sind sie in mein Leben eingebrochen? Ich fragte ja nur. Und die Antwort, die flattert im Wind umher, um mit einem pensionierten Protestsänger zu sprechen. Meine Alben mit den Zeitungsausschnitten über Gro Harlem Brundtland hatten sie beschlagnahmt. Vermutlich waren sie schon längst vernichtet. Nun gut. Einen echten Elling kann man auf diese Weise nicht brechen. Sie verboten mir, über sie zu sprechen. Gut. Also schwieg ich. Es paßte mir ganz ausgezeichnet, über fast alles zu schweigen.
(Blutsbrüder, S. 10)
Hundert Jahre vor meiner Zeit malte Edvard Munch ein Bild namens „Abend auf Karl Johan“. Ich weiß noch, daß dieses Bild in irgendeinem Schulbuch abgebildet war. Und daß es mich schon damals tief beeindruckt hat. Es zeigt viele Menschen, die in Richtung Schloß über Karl Johan strömen. Ihre Gesichter sind bleich, fast grünlich, ihre Augen groß und leer. Sie scheinen gerade erst aus dem Grab auferstanden zu sein. Und über die leere Fahrbahn geht, genau in Gegenrichtung zu allen anderen, eine dunkel gekleidete Gestalt. Wie bei so vielen Bildern von Munch beschleicht mich ein Gefühl der Einsamkeit, wenn ich es mir ansehe, es macht mir fast schon Bauchweh. Ich glaube, das war meine erste Begegnung mit Munchs Welt, und deshalb hat dieser Anblick mich vielleicht so erschüttert. Bis dahin hatte ich Gemälde für etwas gehalten, das man sich zur Dekoration an die Wand hängt. Daß sie etwas mit uns machen können, hatte ich einfach nicht gewußt. Aber auf seltsame Weise erkannte ich mich in diesem Bild wieder. Ich wußte, daß ich dort über die Straße ging, weg von allen anderen, vom Hauptstrom. Mir saß diese Stimmung gewissermaßen unter der Haut. Natürlich wurden in meiner Klasse Witze über dieses Bild gerissen. Die Scherzkekse zogen sich an Munchs Farbgebung hoch und wiesen darauf hin, daß die Menschen in Wirklichkeit nicht so aussehen. Viele Jahre später, als ich auf den Kulturseiten von Arbeiderbladet einen Artikel über Munch las, stellte sich heraus, daß Munchs Zeitgenossen auch nicht anders reagiert hatten. Ich hätte weinen mögen, als ich das las, denn mir ging dabei auf, wie einsam er gewesen sein mußte. In dem Artikel standen auch Auszüge aus den Tagebüchern des Malers. Einer behandelte das erwähnte Bild „Abend auf Karl Johan“. Munch schreibt von einer soeben beendeten unglücklichen Liebesaffäre. Einsam und verlassen läßt er sich durch die Straßen treiben, weg von der Gemeinschaft. Er schreibt, daß es um ihn herum plötzlich so still wird. Die Wirklichkeit scheint sich aufzulösen, und bleiche Gesichter starren ihn an. Mit diesen Worten und mit dem Bild beschrieb er das, was ich selbst nicht in Worte fassen konnte, was ich aber so oft empfand. Ich bewegte mich zwischen anderen Kulissen, das schon. Aber mein Erleben der Wirklichkeit kam dem des großen Künstlers verblüffend nahe. Mich konnte es überfallen, wenn ich auf dem Weg zum Laden war, Mutters Einkaufskarre in der einen und den Einkaufszettel in der anderen Hand. Stille senkte sich um mich herum, und die Gesichter der Menschen auf den Gehwegen zwischen den Blocks verzerrten sich. Ich hatte den Eindruck, daß sie mir übelwollten, daß sie es auf irgendeine Weise auf mich abgesehen hatten. Und ich kann ja auch nicht leugnen, daß genau das oft der Fall war, wir hatten zum Beispiel eine gemeine Bande von Jungen, die um das Einkaufszentrum herumlungerten und schrecklich gern meinen Kopf in Mutters Einkaufskarre preßten. Aber auch sonst, wenn keine Gefahr drohte, glitt ich aus dem Zusammenhang heraus und war vor Angst wie gelähmt. Es kam auch vor, daß ich ganz einfach an meiner Existenz zweifelte. Oder, genauer gesagt, daß ich das Gefühl hatte zu verschwinden. Mich aufzulösen. In solchen Fällen kam es vor, daß ich versuchte, mir etwas anzutun. Das heißt, das glaubten die Außenstehenden. Nicht einmal meine eigene Mutter konnte begreifen, daß ich mich mit Eschenzweigen peitschte oder mir mit der flachen Hand ins Gesicht schlug, um wieder Kontakt zu mir selber zu finden. Und ich konnte das auch nicht vernünftig erklären. Ich brachte nur Schluchzen und abgehackte Wortfetzen zustande.
(Blutsbrüder, S. 41ff.)
In meiner Jugend hatte ich mit genug Psychologen gesprochen. Mehr war dazu nicht zu sagen. Auch als Junge hatte ich schon nicht viel auf dem Herzen gehabt, aber jetzt war alles blank. Ich konnte diese Aufmerksamkeit eines für mich wildfremden Mannes mit einem Examen in Psychologie einfach nicht begreifen.
(Blutsbrüder, S. 47)





 Uckermärkische Bühnen Schwedt
Uckermärkische Bühnen Schwedt