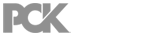Schauspiel
Elling
Schauspiel von Axel Hellstenius (unter Mitwirkung von Petter Næss) nach dem Roman „Blutsbrüder“ von Ingvar Ambjørnsen, Übersetzt aus dem Norwegischen von Gabriele Haefs
Sind wir nicht alle ein bißchen Elling?
Da gibt es die einen, für die ist eine Expedition zum Südpol etwas fast Alltägliches...
...und dann gibt es die anderen, für die ist schon der Gang quer durchs Restaurant ein großes Abenteuer.
Von diesen anderen erzählt „Elling“.
Elling und Kjell Bjarne werden, nachdem sie sich längere Zeit in der Nervenheilanstalt Brøynes „erholen“ konnten, in die „normale“ Welt entlassen: Die Stadt Oslo stellt ihnen eine Wohnung zur Verfügung und einen Sozialarbeiter zur Seite. Um die Wohnung behalten zu dürfen, müssen die beiden Männer allerdings beweisen, daß sie sich wie „normale“ Menschen benehmen können. Das heißt: kochen, putzen, einkaufen gehen, ans Telefon gehen, Kontakte knüpfen, Bekanntschaften schließen...
Regie:Olaf Hilliger
Ausstattung: Andreas Rank
Deutschsprachige Aufführungsrechte bei Whale Songs, Hamburg
Premiere: 9. September 2004
Abgespielt.
Da gibt es die einen, für die ist eine Expedition zum Südpol etwas fast Alltägliches...
...und dann gibt es die anderen, für die ist schon der Gang quer durchs Restaurant ein großes Abenteuer.
Von diesen anderen erzählt „Elling“.
Elling und Kjell Bjarne werden, nachdem sie sich längere Zeit in der Nervenheilanstalt Brøynes „erholen“ konnten, in die „normale“ Welt entlassen: Die Stadt Oslo stellt ihnen eine Wohnung zur Verfügung und einen Sozialarbeiter zur Seite. Um die Wohnung behalten zu dürfen, müssen die beiden Männer allerdings beweisen, daß sie sich wie „normale“ Menschen benehmen können. Das heißt: kochen, putzen, einkaufen gehen, ans Telefon gehen, Kontakte knüpfen, Bekanntschaften schließen...
Regie:
Ausstattung: Andreas Rank
Deutschsprachige Aufführungsrechte bei Whale Songs, Hamburg
Premiere: 9. September 2004
Abgespielt.

Uraufführung: 10.04.1999 Oslo Nye Teater Centralteateret, Oslo
Deutschsprachige Erstaufführung: 20.03.2003 Schmidts Tivoli, Hamburg
Australische Erstaufführung: 20.03.2003 Belvoir Theater, Sydney
Österreichische Erstaufführung: 14.10.2003 Theater Drachengasse, Wien
Ungarische Erstaufführung: 25.11.2003 Vörösmarty Színház, Székesfehérvár
Schweizer Erstaufführung: 13.01.2004 Theater Neumarkt, Zürich
Ingvar Ambjørnsen hat seit 1992 vier Bücher über Elling geschrieben. Der dritte Roman dieser Serie wurde von Axel Hellstenius dramatisiert und 1999 von Petter Næss in Oslo inszeniert. „Elling“ war in Oslo ursprünglich für zehn Vorstellungen geplant, hatte dann aber solchen Erfolg, daß es zwei Monate lief. Einige Monate später, als der Kjell-Bjarne-Darsteller wieder abkömmlich war, wurde das Stück erneut auf den Spielplan gesetzt und lief noch ein halbes Jahr vor vollem Haus, gastierte in vielen anderen norwegischen Städten und war – mit insgesamt 120 Vorstellungen – einfach die Theatersensation des Jahres 1999.
2001 entstand auf der Grundlage des Theatertextes, von dem er sich gleichzeitig bewußt abzusetzen bestrebt war, der Film – wiederum in der Regie von Petter Næss und mit den beiden Hauptdarstellern der Uraufführung. 2002 war der Film, den jeder fünfte Norweger im Kino gesehen hat, für den Oscar in der Kategorie „Best Foreign Language Film of the Year“ nominiert.
Am 06.05. startet – auf dem zweiten Roman der Reihe, „Ententanz“, basierend – der zweite Elling-Film „Nicht ohne meine Mutter“ in Deutschland. Ein zweites Theaterstück gibt es inzwischen ebenfalls; es wird derzeit ins Deutsche übersetzt.
Das Stück bezieht sowohl seine Tragik als auch seine Komik aus dem Zusammenprall unterschiedlicher Vorstellungen und Realitätswahrnehmungen. Und wie fast immer, wenn das so genannte Verrückte auf die angebliche Normalität trifft, sieht Letztere manchmal ganz schön alt aus.
VOLKER BEHRENS, HAMBURGER ABENDBLATT, 20.03.03
Eine kleine, feine Geschichte eigentlich, so schlicht und verschroben wie die Gemüter ihrer scheuen Protagonisten.
MAIKE SCHILLER, HAMBURGER ABENDBLATT, 22./23.03.03
Der Text ist umwerfend witzig und das Stück hat alles, was ein gutes Theaterstück braucht. Spannung, Tiefgang, Leichtigkeit und Tempo. (...) Am Schluß hätten wohl alle Zuschauer liebend gern noch ein paar Stunden weiter am Leben der beiden teilgenommen.
SÜDWESTRUNDFUNK (SWR), 21.03.03
Deutschsprachige Erstaufführung: 20.03.2003 Schmidts Tivoli, Hamburg
Australische Erstaufführung: 20.03.2003 Belvoir Theater, Sydney
Österreichische Erstaufführung: 14.10.2003 Theater Drachengasse, Wien
Ungarische Erstaufführung: 25.11.2003 Vörösmarty Színház, Székesfehérvár
Schweizer Erstaufführung: 13.01.2004 Theater Neumarkt, Zürich
Ingvar Ambjørnsen hat seit 1992 vier Bücher über Elling geschrieben. Der dritte Roman dieser Serie wurde von Axel Hellstenius dramatisiert und 1999 von Petter Næss in Oslo inszeniert. „Elling“ war in Oslo ursprünglich für zehn Vorstellungen geplant, hatte dann aber solchen Erfolg, daß es zwei Monate lief. Einige Monate später, als der Kjell-Bjarne-Darsteller wieder abkömmlich war, wurde das Stück erneut auf den Spielplan gesetzt und lief noch ein halbes Jahr vor vollem Haus, gastierte in vielen anderen norwegischen Städten und war – mit insgesamt 120 Vorstellungen – einfach die Theatersensation des Jahres 1999.
2001 entstand auf der Grundlage des Theatertextes, von dem er sich gleichzeitig bewußt abzusetzen bestrebt war, der Film – wiederum in der Regie von Petter Næss und mit den beiden Hauptdarstellern der Uraufführung. 2002 war der Film, den jeder fünfte Norweger im Kino gesehen hat, für den Oscar in der Kategorie „Best Foreign Language Film of the Year“ nominiert.
Am 06.05. startet – auf dem zweiten Roman der Reihe, „Ententanz“, basierend – der zweite Elling-Film „Nicht ohne meine Mutter“ in Deutschland. Ein zweites Theaterstück gibt es inzwischen ebenfalls; es wird derzeit ins Deutsche übersetzt.
Das Stück bezieht sowohl seine Tragik als auch seine Komik aus dem Zusammenprall unterschiedlicher Vorstellungen und Realitätswahrnehmungen. Und wie fast immer, wenn das so genannte Verrückte auf die angebliche Normalität trifft, sieht Letztere manchmal ganz schön alt aus.
VOLKER BEHRENS, HAMBURGER ABENDBLATT, 20.03.03
Eine kleine, feine Geschichte eigentlich, so schlicht und verschroben wie die Gemüter ihrer scheuen Protagonisten.
MAIKE SCHILLER, HAMBURGER ABENDBLATT, 22./23.03.03
Der Text ist umwerfend witzig und das Stück hat alles, was ein gutes Theaterstück braucht. Spannung, Tiefgang, Leichtigkeit und Tempo. (...) Am Schluß hätten wohl alle Zuschauer liebend gern noch ein paar Stunden weiter am Leben der beiden teilgenommen.
SÜDWESTRUNDFUNK (SWR), 21.03.03

„The Making of Elling” von Peter Næss
Als Regisseur bin ich selbstverständlich immer auf der Suche nach guten Ideen, Geschichten und Figuren, mit denen ich mich identifizieren kann. Als ich die Geschichte von Elling ent-deckte, wusste ich sofort, dass dies eine Geschichte ist, die ich unbedingt erzählen muss. Elling sagt an einer Stelle: „Es gibt Menschen, die sich mit Skiern auf den Weg zum Südpol machen und ich, ich habe schon Probleme, ein Restaurant zu durchqueren, um pinkeln zu gehen.“
Ich denke, dies ist einer der wesentlichen Gründe für die Popularität von Elling. Wir alle kämpfen auf verschiedensten Ebenen ständig damit, eigene Grenzen zu überschreiten und innere Hürden zu überwinden. Für mich ist dies eine Geschichte über meine eigenen Ängste und Phobien und den Versuch, die daraus resultierenden Blockaden zu durchbrechen.
Eigentlich bin ich Theaterregisseur, und ELLING existierte zuerst als Theaterstück, das ich in Oslo aufführte. Es war ein großer Erfolg, aber ich war mir nicht sicher, ob ich daraus tatsächlich einen Film machen wollte. Ich hatte mit der Geschichte einmal Erfolg gehabt und dachte, das sollte eigentlich genügen. Aber nach längerer Überlegung sah ich darin die Chance, noch tiefer in die Materie eintauchen zu können, die Geschichte zu erweitern und den Fokus noch stärker auf diese wunderbaren Figuren zu richten.
Ich wollte einen Film über die menschlichen Fähigkeiten drehen, der herzerwärmend ist und uns Hoffnung gibt. Das Thema der Freundschaft interessierte mich ebenfalls sehr. Mir war es wichtig zu betonen, dass sie füreinander da sind.
Ich wollte auf keinen Fall einen Film über Menschen in der Psychiatrie drehen. Diese Jungs haben keine diagnostizierte Krankheit. Ihr Problem ist, dass sie über keinerlei soziale Erfahrung verfügen. Niemand gab ihnen je die Gelegenheit, sich zu beweisen oder hatte gar Vertrauen in sie. Für mich war es wichtig, Möglichkeiten und menschliche Qualitäten von Personen zu zeigen, die man augenscheinlich nicht von ihnen erwarten würde.
Das ist es, warum ich diesen Film drehen wollte.
Nach der Entscheidung, diesen Film zu machen, schrieb ich sechs Monate das Drehbuch um. In der Theaterversion beginnt das Stück mit ihrer Ankunft in ihrer Sozialwohnung. Wir konzentrierten uns fast ausschließlich auf ihr Leben in dieser Wohnung. Für die Filmversion wollten wir sie unbedingt mehr der Begegnung mit der sogenannten normalen Gesellschaft aussetzen. Darüber hinaus wollten wir zusätzliche Figuren einbringen. So existierte z.B. der ältere Dichter Alfons Jørgensen nicht in der Theaterversion.
Der Produzent und ich waren uns einig, dass die Hauptrollen nicht von Per Christian und Sven gespielt werden sollten, da sie sie schon im Theater gespielt hatten. Aber nach zwei Monaten intensiven Castings kamen wir auf sie zurück ... sie hatten 120 Aufführungen des Theaterstückes gespielt und wir mussten feststellen, dass sie am besten vorbereitet waren und die glaubwürdigsten Schauspieler waren, die wir finden konnten.
Dies ist mein zweiter Spielfilm, und vom Theater kommend, habe ich die Idee von Proben mitgebracht. Eine Idee, die für den traditionellen norwegischen Film sehr ungewöhnlich ist. Bei beiden Filmen hatte ich fünf Wochen Zeit mit dem Drehbuch zu proben, die Szene zu inszenieren und die Schauspieler vom Theater weg hin zum Film zu bewegen. Mir ist es lieber, viel Zeit in die Proben zu investieren, als Drehzeit zu verlieren. Mein erster Film wurde in 25 Drehtagen gedreht, ELLING benötigte 34 Drehtage. Es ist weitaus billiger zu proben und die Schauspieler bekommen darüber hinaus die Möglichkeit, sich aufeinander einzustellen und das Team auf dem Set kennen zu lernen.
Die Figuren in ELLING sind starke Persönlichkeiten, aber sie verhalten sich eben nicht wie „normale“ Leute. Es war sehr wichtig und unglaublich schwer, eine bestimmte Art der Skurrilität zu erreichen. Einen Schauspielstil zu finden und eine Ausgewogenheit zwischen Humor und Ernsthaftigkeit zu erlangen. Ich wollte, dass das Publikum lacht, weil es mit den Figuren fühlt, nicht weil es sie seltsam findet. Wir haben für ELLING nicht in Psychiatrien recherchiert. Wir haben uns vollkommen auf unsere eigenen Erfahrungen und unsere persönliche Identifizierung mit den Figuren und der Geschichte verlassen. Das einzige Problem war, ein Gleichgewicht zwischen Komödie und Drama zu finden. Während der ganzen Zeit vom Schreiben des Drehbuchs über Casting, Proben und Dreh bis zum Schnitt des Filmes haben wir darum gekämpft. Und ich bin überzeugt, dass der Grund für diese immense Popularität dieses Filmes der ist, dass wir dieses Gleichgewicht herstellen konnten.
Ich wollte einen unprätentiösen Film drehen. Ich stützte mich vollkommen auf die Geschichte und erzählte sie durch die Schauspieler. Das war sicher eine Gratwanderung, denn wäre es den Schauspielern nicht gelungen, „real“ zu erscheinen, dann hätte es keinen Film gegeben.
Als Regisseur bin ich selbstverständlich immer auf der Suche nach guten Ideen, Geschichten und Figuren, mit denen ich mich identifizieren kann. Als ich die Geschichte von Elling ent-deckte, wusste ich sofort, dass dies eine Geschichte ist, die ich unbedingt erzählen muss. Elling sagt an einer Stelle: „Es gibt Menschen, die sich mit Skiern auf den Weg zum Südpol machen und ich, ich habe schon Probleme, ein Restaurant zu durchqueren, um pinkeln zu gehen.“
Ich denke, dies ist einer der wesentlichen Gründe für die Popularität von Elling. Wir alle kämpfen auf verschiedensten Ebenen ständig damit, eigene Grenzen zu überschreiten und innere Hürden zu überwinden. Für mich ist dies eine Geschichte über meine eigenen Ängste und Phobien und den Versuch, die daraus resultierenden Blockaden zu durchbrechen.
Eigentlich bin ich Theaterregisseur, und ELLING existierte zuerst als Theaterstück, das ich in Oslo aufführte. Es war ein großer Erfolg, aber ich war mir nicht sicher, ob ich daraus tatsächlich einen Film machen wollte. Ich hatte mit der Geschichte einmal Erfolg gehabt und dachte, das sollte eigentlich genügen. Aber nach längerer Überlegung sah ich darin die Chance, noch tiefer in die Materie eintauchen zu können, die Geschichte zu erweitern und den Fokus noch stärker auf diese wunderbaren Figuren zu richten.
Ich wollte einen Film über die menschlichen Fähigkeiten drehen, der herzerwärmend ist und uns Hoffnung gibt. Das Thema der Freundschaft interessierte mich ebenfalls sehr. Mir war es wichtig zu betonen, dass sie füreinander da sind.
Ich wollte auf keinen Fall einen Film über Menschen in der Psychiatrie drehen. Diese Jungs haben keine diagnostizierte Krankheit. Ihr Problem ist, dass sie über keinerlei soziale Erfahrung verfügen. Niemand gab ihnen je die Gelegenheit, sich zu beweisen oder hatte gar Vertrauen in sie. Für mich war es wichtig, Möglichkeiten und menschliche Qualitäten von Personen zu zeigen, die man augenscheinlich nicht von ihnen erwarten würde.
Das ist es, warum ich diesen Film drehen wollte.
Nach der Entscheidung, diesen Film zu machen, schrieb ich sechs Monate das Drehbuch um. In der Theaterversion beginnt das Stück mit ihrer Ankunft in ihrer Sozialwohnung. Wir konzentrierten uns fast ausschließlich auf ihr Leben in dieser Wohnung. Für die Filmversion wollten wir sie unbedingt mehr der Begegnung mit der sogenannten normalen Gesellschaft aussetzen. Darüber hinaus wollten wir zusätzliche Figuren einbringen. So existierte z.B. der ältere Dichter Alfons Jørgensen nicht in der Theaterversion.
Der Produzent und ich waren uns einig, dass die Hauptrollen nicht von Per Christian und Sven gespielt werden sollten, da sie sie schon im Theater gespielt hatten. Aber nach zwei Monaten intensiven Castings kamen wir auf sie zurück ... sie hatten 120 Aufführungen des Theaterstückes gespielt und wir mussten feststellen, dass sie am besten vorbereitet waren und die glaubwürdigsten Schauspieler waren, die wir finden konnten.
Dies ist mein zweiter Spielfilm, und vom Theater kommend, habe ich die Idee von Proben mitgebracht. Eine Idee, die für den traditionellen norwegischen Film sehr ungewöhnlich ist. Bei beiden Filmen hatte ich fünf Wochen Zeit mit dem Drehbuch zu proben, die Szene zu inszenieren und die Schauspieler vom Theater weg hin zum Film zu bewegen. Mir ist es lieber, viel Zeit in die Proben zu investieren, als Drehzeit zu verlieren. Mein erster Film wurde in 25 Drehtagen gedreht, ELLING benötigte 34 Drehtage. Es ist weitaus billiger zu proben und die Schauspieler bekommen darüber hinaus die Möglichkeit, sich aufeinander einzustellen und das Team auf dem Set kennen zu lernen.
Die Figuren in ELLING sind starke Persönlichkeiten, aber sie verhalten sich eben nicht wie „normale“ Leute. Es war sehr wichtig und unglaublich schwer, eine bestimmte Art der Skurrilität zu erreichen. Einen Schauspielstil zu finden und eine Ausgewogenheit zwischen Humor und Ernsthaftigkeit zu erlangen. Ich wollte, dass das Publikum lacht, weil es mit den Figuren fühlt, nicht weil es sie seltsam findet. Wir haben für ELLING nicht in Psychiatrien recherchiert. Wir haben uns vollkommen auf unsere eigenen Erfahrungen und unsere persönliche Identifizierung mit den Figuren und der Geschichte verlassen. Das einzige Problem war, ein Gleichgewicht zwischen Komödie und Drama zu finden. Während der ganzen Zeit vom Schreiben des Drehbuchs über Casting, Proben und Dreh bis zum Schnitt des Filmes haben wir darum gekämpft. Und ich bin überzeugt, dass der Grund für diese immense Popularität dieses Filmes der ist, dass wir dieses Gleichgewicht herstellen konnten.
Ich wollte einen unprätentiösen Film drehen. Ich stützte mich vollkommen auf die Geschichte und erzählte sie durch die Schauspieler. Das war sicher eine Gratwanderung, denn wäre es den Schauspielern nicht gelungen, „real“ zu erscheinen, dann hätte es keinen Film gegeben.

Elling über Elling
Von größeren Versammlungen wird mir immer schlecht. Ich mag Menschen, möchte aber lieber eine gewisse Distanz halten. Sie zum Beispiel vom Fenster aus sehen. Im Grunde ist das ganz einfach: Ich finde es nun mal unmöglich, eine enge Beziehung, eine Vertrauensbeziehung zu einer Menschenmenge zu haben. Und ich glaube Leuten nicht, die behaupten, sie hätten eine. Die lügen. Vertrauen kann man zu einem Menschen haben, vielleicht noch zu zweien. Die Masse wird zu einer Mauer aus Fleisch und verworrenen Absichten. Die Masse ist das Unberechenbare. Das vielköpfige Ungeheuer, das uns am Palmsonntag zujubelt und uns am nächsten Freitag ans Kreuz schlägt. Deshalb war ich, als Gunn mich als „Elling – unser Neuer“ vorstellte, auf das Schlimmste vorbereitet. Ich hatte schließlich gesehen, wie zu Hause auf dem Schulhof neue Schüler behandelt worden waren.
(Blutsbrüder, S. 18f.)
Ich bin nicht unzugänglich, aber meine Freundschaft gibt es nicht im Sonderangebot. Ich teile mich nicht mit jedem. Ein Mann ohne Stolz ist ein Mann ohne festen Boden unter den Füßen. So einfach ist das. Mit welchem Recht sind sie in mein Leben eingebrochen? Ich fragte ja nur. Und die Antwort, die flattert im Wind umher, um mit einem pensionierten Protestsänger zu sprechen. Meine Alben mit den Zeitungsausschnitten über Gro Harlem Brundtland hatten sie beschlagnahmt. Vermutlich waren sie schon längst vernichtet. Nun gut. Einen echten Elling kann man auf diese Weise nicht brechen. Sie verboten mir, über sie zu sprechen. Gut. Also schwieg ich. Es paßte mir ganz ausgezeichnet, über fast alles zu schweigen.
(Blutsbrüder, S. 10)
Hundert Jahre vor meiner Zeit malte Edvard Munch ein Bild namens „Abend auf Karl Johan“. Ich weiß noch, daß dieses Bild in irgendeinem Schulbuch abgebildet war. Und daß es mich schon damals tief beeindruckt hat. Es zeigt viele Menschen, die in Richtung Schloß über Karl Johan strömen. Ihre Gesichter sind bleich, fast grünlich, ihre Augen groß und leer. Sie scheinen gerade erst aus dem Grab auferstanden zu sein. Und über die leere Fahrbahn geht, genau in Gegenrichtung zu allen anderen, eine dunkel gekleidete Gestalt. Wie bei so vielen Bildern von Munch beschleicht mich ein Gefühl der Einsamkeit, wenn ich es mir ansehe, es macht mir fast schon Bauchweh. Ich glaube, das war meine erste Begegnung mit Munchs Welt, und deshalb hat dieser Anblick mich vielleicht so erschüttert. Bis dahin hatte ich Gemälde für etwas gehalten, das man sich zur Dekoration an die Wand hängt. Daß sie etwas mit uns machen können, hatte ich einfach nicht gewußt. Aber auf seltsame Weise erkannte ich mich in diesem Bild wieder. Ich wußte, daß ich dort über die Straße ging, weg von allen anderen, vom Hauptstrom. Mir saß diese Stimmung gewissermaßen unter der Haut. Natürlich wurden in meiner Klasse Witze über dieses Bild gerissen. Die Scherzkekse zogen sich an Munchs Farbgebung hoch und wiesen darauf hin, daß die Menschen in Wirklichkeit nicht so aussehen. Viele Jahre später, als ich auf den Kulturseiten von Arbeiderbladet einen Artikel über Munch las, stellte sich heraus, daß Munchs Zeitgenossen auch nicht anders reagiert hatten. Ich hätte weinen mögen, als ich das las, denn mir ging dabei auf, wie einsam er gewesen sein mußte. In dem Artikel standen auch Auszüge aus den Tagebüchern des Malers. Einer behandelte das erwähnte Bild „Abend auf Karl Johan“. Munch schreibt von einer soeben beendeten unglücklichen Liebesaffäre. Einsam und verlassen läßt er sich durch die Straßen treiben, weg von der Gemeinschaft. Er schreibt, daß es um ihn herum plötzlich so still wird. Die Wirklichkeit scheint sich aufzulösen, und bleiche Gesichter starren ihn an. Mit diesen Worten und mit dem Bild beschrieb er das, was ich selbst nicht in Worte fassen konnte, was ich aber so oft empfand. Ich bewegte mich zwischen anderen Kulissen, das schon. Aber mein Erleben der Wirklichkeit kam dem des großen Künstlers verblüffend nahe. Mich konnte es überfallen, wenn ich auf dem Weg zum Laden war, Mutters Einkaufskarre in der einen und den Einkaufszettel in der anderen Hand. Stille senkte sich um mich herum, und die Gesichter der Menschen auf den Gehwegen zwischen den Blocks verzerrten sich. Ich hatte den Eindruck, daß sie mir übelwollten, daß sie es auf irgendeine Weise auf mich abgesehen hatten. Und ich kann ja auch nicht leugnen, daß genau das oft der Fall war, wir hatten zum Beispiel eine gemeine Bande von Jungen, die um das Einkaufszentrum herumlungerten und schrecklich gern meinen Kopf in Mutters Einkaufskarre preßten. Aber auch sonst, wenn keine Gefahr drohte, glitt ich aus dem Zusammenhang heraus und war vor Angst wie gelähmt. Es kam auch vor, daß ich ganz einfach an meiner Existenz zweifelte. Oder, genauer gesagt, daß ich das Gefühl hatte zu verschwinden. Mich aufzulösen. In solchen Fällen kam es vor, daß ich versuchte, mir etwas anzutun. Das heißt, das glaubten die Außenstehenden. Nicht einmal meine eigene Mutter konnte begreifen, daß ich mich mit Eschenzweigen peitschte oder mir mit der flachen Hand ins Gesicht schlug, um wieder Kontakt zu mir selber zu finden. Und ich konnte das auch nicht vernünftig erklären. Ich brachte nur Schluchzen und abgehackte Wortfetzen zustande.
(Blutsbrüder, S. 41ff.)
In meiner Jugend hatte ich mit genug Psychologen gesprochen. Mehr war dazu nicht zu sagen. Auch als Junge hatte ich schon nicht viel auf dem Herzen gehabt, aber jetzt war alles blank. Ich konnte diese Aufmerksamkeit eines für mich wildfremden Mannes mit einem Examen in Psychologie einfach nicht begreifen.
(Blutsbrüder, S. 47)
Von größeren Versammlungen wird mir immer schlecht. Ich mag Menschen, möchte aber lieber eine gewisse Distanz halten. Sie zum Beispiel vom Fenster aus sehen. Im Grunde ist das ganz einfach: Ich finde es nun mal unmöglich, eine enge Beziehung, eine Vertrauensbeziehung zu einer Menschenmenge zu haben. Und ich glaube Leuten nicht, die behaupten, sie hätten eine. Die lügen. Vertrauen kann man zu einem Menschen haben, vielleicht noch zu zweien. Die Masse wird zu einer Mauer aus Fleisch und verworrenen Absichten. Die Masse ist das Unberechenbare. Das vielköpfige Ungeheuer, das uns am Palmsonntag zujubelt und uns am nächsten Freitag ans Kreuz schlägt. Deshalb war ich, als Gunn mich als „Elling – unser Neuer“ vorstellte, auf das Schlimmste vorbereitet. Ich hatte schließlich gesehen, wie zu Hause auf dem Schulhof neue Schüler behandelt worden waren.
(Blutsbrüder, S. 18f.)
Ich bin nicht unzugänglich, aber meine Freundschaft gibt es nicht im Sonderangebot. Ich teile mich nicht mit jedem. Ein Mann ohne Stolz ist ein Mann ohne festen Boden unter den Füßen. So einfach ist das. Mit welchem Recht sind sie in mein Leben eingebrochen? Ich fragte ja nur. Und die Antwort, die flattert im Wind umher, um mit einem pensionierten Protestsänger zu sprechen. Meine Alben mit den Zeitungsausschnitten über Gro Harlem Brundtland hatten sie beschlagnahmt. Vermutlich waren sie schon längst vernichtet. Nun gut. Einen echten Elling kann man auf diese Weise nicht brechen. Sie verboten mir, über sie zu sprechen. Gut. Also schwieg ich. Es paßte mir ganz ausgezeichnet, über fast alles zu schweigen.
(Blutsbrüder, S. 10)
Hundert Jahre vor meiner Zeit malte Edvard Munch ein Bild namens „Abend auf Karl Johan“. Ich weiß noch, daß dieses Bild in irgendeinem Schulbuch abgebildet war. Und daß es mich schon damals tief beeindruckt hat. Es zeigt viele Menschen, die in Richtung Schloß über Karl Johan strömen. Ihre Gesichter sind bleich, fast grünlich, ihre Augen groß und leer. Sie scheinen gerade erst aus dem Grab auferstanden zu sein. Und über die leere Fahrbahn geht, genau in Gegenrichtung zu allen anderen, eine dunkel gekleidete Gestalt. Wie bei so vielen Bildern von Munch beschleicht mich ein Gefühl der Einsamkeit, wenn ich es mir ansehe, es macht mir fast schon Bauchweh. Ich glaube, das war meine erste Begegnung mit Munchs Welt, und deshalb hat dieser Anblick mich vielleicht so erschüttert. Bis dahin hatte ich Gemälde für etwas gehalten, das man sich zur Dekoration an die Wand hängt. Daß sie etwas mit uns machen können, hatte ich einfach nicht gewußt. Aber auf seltsame Weise erkannte ich mich in diesem Bild wieder. Ich wußte, daß ich dort über die Straße ging, weg von allen anderen, vom Hauptstrom. Mir saß diese Stimmung gewissermaßen unter der Haut. Natürlich wurden in meiner Klasse Witze über dieses Bild gerissen. Die Scherzkekse zogen sich an Munchs Farbgebung hoch und wiesen darauf hin, daß die Menschen in Wirklichkeit nicht so aussehen. Viele Jahre später, als ich auf den Kulturseiten von Arbeiderbladet einen Artikel über Munch las, stellte sich heraus, daß Munchs Zeitgenossen auch nicht anders reagiert hatten. Ich hätte weinen mögen, als ich das las, denn mir ging dabei auf, wie einsam er gewesen sein mußte. In dem Artikel standen auch Auszüge aus den Tagebüchern des Malers. Einer behandelte das erwähnte Bild „Abend auf Karl Johan“. Munch schreibt von einer soeben beendeten unglücklichen Liebesaffäre. Einsam und verlassen läßt er sich durch die Straßen treiben, weg von der Gemeinschaft. Er schreibt, daß es um ihn herum plötzlich so still wird. Die Wirklichkeit scheint sich aufzulösen, und bleiche Gesichter starren ihn an. Mit diesen Worten und mit dem Bild beschrieb er das, was ich selbst nicht in Worte fassen konnte, was ich aber so oft empfand. Ich bewegte mich zwischen anderen Kulissen, das schon. Aber mein Erleben der Wirklichkeit kam dem des großen Künstlers verblüffend nahe. Mich konnte es überfallen, wenn ich auf dem Weg zum Laden war, Mutters Einkaufskarre in der einen und den Einkaufszettel in der anderen Hand. Stille senkte sich um mich herum, und die Gesichter der Menschen auf den Gehwegen zwischen den Blocks verzerrten sich. Ich hatte den Eindruck, daß sie mir übelwollten, daß sie es auf irgendeine Weise auf mich abgesehen hatten. Und ich kann ja auch nicht leugnen, daß genau das oft der Fall war, wir hatten zum Beispiel eine gemeine Bande von Jungen, die um das Einkaufszentrum herumlungerten und schrecklich gern meinen Kopf in Mutters Einkaufskarre preßten. Aber auch sonst, wenn keine Gefahr drohte, glitt ich aus dem Zusammenhang heraus und war vor Angst wie gelähmt. Es kam auch vor, daß ich ganz einfach an meiner Existenz zweifelte. Oder, genauer gesagt, daß ich das Gefühl hatte zu verschwinden. Mich aufzulösen. In solchen Fällen kam es vor, daß ich versuchte, mir etwas anzutun. Das heißt, das glaubten die Außenstehenden. Nicht einmal meine eigene Mutter konnte begreifen, daß ich mich mit Eschenzweigen peitschte oder mir mit der flachen Hand ins Gesicht schlug, um wieder Kontakt zu mir selber zu finden. Und ich konnte das auch nicht vernünftig erklären. Ich brachte nur Schluchzen und abgehackte Wortfetzen zustande.
(Blutsbrüder, S. 41ff.)
In meiner Jugend hatte ich mit genug Psychologen gesprochen. Mehr war dazu nicht zu sagen. Auch als Junge hatte ich schon nicht viel auf dem Herzen gehabt, aber jetzt war alles blank. Ich konnte diese Aufmerksamkeit eines für mich wildfremden Mannes mit einem Examen in Psychologie einfach nicht begreifen.
(Blutsbrüder, S. 47)

Elling über Kjell Bjarne
Er war ein großer Bursche in meinem Alter. Mit schütterem Haar und einem düsteren Kabeljaugesicht, das durchaus nichts Gutes verhieß. Ich wollte wieder gehen, aber Gunn hielt mich zurück. Und dann wurden wir einander vorgestellt. Ich kam mir vor wie der eine Bräutigam bei einer verbotenen pakistanischen Schwulenhochzeit. Elling, das ist Kjell Bjarne. Du hast ihn zwar noch nie gesehen, aber er ist der Mann deines Lebens. Von nun an sollt ihr in guten wie in bösen Zeiten zusammen wohnen. Er wird genau wie du in Verwahrung gehalten, und irgendwie werdet ihr euch schon zusammenraufen. Ich hätte am liebsten geweint.
(Ententanz, S. 13f.)
Wie Kjell Bjarne es mit der Verantwortung hielt, wußte ich nicht. Er erzählte nur wenig über seine Vergangenheit, abgesehen davon, daß er seine Eltern haßte.
(Blutsbrüder, S. 32)
Ich wußte, daß er (Kjell Bjarne) aus der normalen Schule in eine Sonderklasse versetzt worden war, wo die Lehrer ihre Zeit vor allem mit dem Versuch verbracht hatten, ihm das ABC und das kleine Einmaleins einzubimsen. Und zu Hause? Am Waldrand, wo er aufgewachsen war? Viel hatte er mir ja nicht erzählt, aber ich wußte immerhin, daß das Gespräch nur selten die Themen Kunst und Kultur gestreift hatte, wenn die Familie sich vor ihre Becher mit Schwarzgebranntem setzte. (Blutsbrüder, S. 61)
Es ließ sich nicht leugnen, daß er manchmal ziemlich übel roch. In Brøynes hatte Gunn ihn bei der Stange gehalten, aber nun hatte Kjell Bjarne seine persönliche Hygiene so ziemlich sausen lassen. Stinkende Socken, wochenlang nicht gewechselte Unterwäsche. (Blutsbrüder, S. 34f.)
Er war ein großer Bursche in meinem Alter. Mit schütterem Haar und einem düsteren Kabeljaugesicht, das durchaus nichts Gutes verhieß. Ich wollte wieder gehen, aber Gunn hielt mich zurück. Und dann wurden wir einander vorgestellt. Ich kam mir vor wie der eine Bräutigam bei einer verbotenen pakistanischen Schwulenhochzeit. Elling, das ist Kjell Bjarne. Du hast ihn zwar noch nie gesehen, aber er ist der Mann deines Lebens. Von nun an sollt ihr in guten wie in bösen Zeiten zusammen wohnen. Er wird genau wie du in Verwahrung gehalten, und irgendwie werdet ihr euch schon zusammenraufen. Ich hätte am liebsten geweint.
(Ententanz, S. 13f.)
Wie Kjell Bjarne es mit der Verantwortung hielt, wußte ich nicht. Er erzählte nur wenig über seine Vergangenheit, abgesehen davon, daß er seine Eltern haßte.
(Blutsbrüder, S. 32)
Ich wußte, daß er (Kjell Bjarne) aus der normalen Schule in eine Sonderklasse versetzt worden war, wo die Lehrer ihre Zeit vor allem mit dem Versuch verbracht hatten, ihm das ABC und das kleine Einmaleins einzubimsen. Und zu Hause? Am Waldrand, wo er aufgewachsen war? Viel hatte er mir ja nicht erzählt, aber ich wußte immerhin, daß das Gespräch nur selten die Themen Kunst und Kultur gestreift hatte, wenn die Familie sich vor ihre Becher mit Schwarzgebranntem setzte. (Blutsbrüder, S. 61)
Es ließ sich nicht leugnen, daß er manchmal ziemlich übel roch. In Brøynes hatte Gunn ihn bei der Stange gehalten, aber nun hatte Kjell Bjarne seine persönliche Hygiene so ziemlich sausen lassen. Stinkende Socken, wochenlang nicht gewechselte Unterwäsche. (Blutsbrüder, S. 34f.)

Elling über seine Mutter
Ich hatte schließlich ein sehr enges Verhältnis zu meiner Mutter gehabt, kein hysterisches, kein gefährliches, so, wie ich es in Büchern gelesen oder im Kino gesehen hatte – aber trotzdem ließ sich nicht leugnen, daß es mein Leben, also zweiunddreißig Jahre lang, nur sie und mich gegeben hatte. Meinen Vater habe ich nicht gekannt, er starb vier Wochen vor meiner Geburt bei einem Arbeitsunfall. Für mich gab es ihn nur in Mutters Erinnerungen, und erst als Erwachsenem wurde mir klar, daß ich ihn vermißte.
(Ausblick auf das Paradies, S. 6)
Mein Leben lang war das mein großer Albtraum gewesen. Daß sich ein fremder Mann zwischen meine Mutter und mich drängte. Nur ein einziges Mal hatte Mutter mir Grund zur Sorge gegeben. Als ich so um die Zwanzig war, hatte ein Witwer, ein gewisser „Sandnes“, es für gut befunden, ab und zu vorbeizuschauen. Ich hatte sofort begriffen, daß die Lage ernst war, und mir eine knallharte Konfrontationstaktik zurechtgelegt. Jedesmal wenn er kam, stellte ich mich mitten ins Zimmer und starrte ihn an. Bis er ging. Mutters Weinen und Flehen traf auf taube Ohren. Ich rührte mich nicht vom Fleck und konnte meinen Blick über eine Stunde durchhalten. Nach zwei Monaten war die Sache gegessen, und Mutter erwähnte ihn mit keinem Wort mehr.
(Ententanz, S. 212)
Mein Leben lang hatte ich mit einer Mutter von schwachem und vagem Charakter zusammengelebt. Ich hatte den Rahmen um unser gemeinsames Dasein erhalten und verhindern müssen, daß alles zur Sinnlosigkeit zerfloß. In all den Jahren hatte ich die Ideen vertreten müssen, die familiäre Ideologie gewissermaßen, während Mutter sich auf ihre schlichte Weise um das Praktische gekümmert hatte. Ich hatte mich daran gewöhnt, ihr aus der weichen Tiefe des Sessels zuzusehen, wenn sie sich um die Topfblumen kümmerte, den Boden putzte oder in meinem Zimmer die Bettwäsche wechselte. Ans Waschbecken gelehnt, hatte ich die Tricks studiert, mit denen sie Frikadellen und Weißkohl, geräucherten Köhler und Königskuchen zubereitete. Als Sozialdemokrat hatte ich immer tiefen Respekt vor der manuellen Arbeit empfunden, vor dem wirklichen Tagewerk. Ich erkannte die Grenzen, ja, die Unbeholfenheit des Intellektuellen, wenn es um Praktisches ging. Und eben deshalb mußte ich Mutter klarmachen, wo zwischen uns die Grenze verlief. Es war nicht egal, wer von uns das Klo putzte. Wenn ich solche Arbeiten verweigerte, faßte sie das oft als Zeichen von Faulheit oder Unwillen meinerseits auf. Aber ich wußte, wenn ich die Ärmel hochkrempelte und ihr zu Willen war, dann würde ich zugleich in ihren geheimen Raum eindringen. Sie ahnte nicht einmal, daß dieser geheime Raum existierte, so geheim war der nämlich, aber ich sah es doch von meinem Sessel aus kristallklar. Mein ruhiges „nein, Mutter“ provozierte sie zwar manchmal, aber in den letzten Jahren ihres Lebens hatte sich wohl zumindest ihr Unterbewußtsein mit dem Stand der Dinge abgefunden. Sie schien sich auf irgendeine Weise damit ausgesöhnt zu haben, daß unsere Arbeitsteilung nun einmal so und nicht anders aussah. Aber jetzt, nach Mutters Tod, war dieses System zusammengebrochen. Innerhalb weniger kurzer Wochen war ich in eine Anarchie gestürzt worden, in der zu allen Tageszeiten Fremde meine Wege kreuzten. Die äußere Ruhe um mein Dasein in einer Blockwohnung am Rande der Landeshauptstadt war jählings einem aufgezwungenen Zimmergenossen und dem Zwang zu sozialem Umgang mit Menschen gewichen, die im Grunde restlos asozial waren.
(Ausblick auf das Paradies, S. 45f.)
Ich hatte schließlich ein sehr enges Verhältnis zu meiner Mutter gehabt, kein hysterisches, kein gefährliches, so, wie ich es in Büchern gelesen oder im Kino gesehen hatte – aber trotzdem ließ sich nicht leugnen, daß es mein Leben, also zweiunddreißig Jahre lang, nur sie und mich gegeben hatte. Meinen Vater habe ich nicht gekannt, er starb vier Wochen vor meiner Geburt bei einem Arbeitsunfall. Für mich gab es ihn nur in Mutters Erinnerungen, und erst als Erwachsenem wurde mir klar, daß ich ihn vermißte.
(Ausblick auf das Paradies, S. 6)
Mein Leben lang war das mein großer Albtraum gewesen. Daß sich ein fremder Mann zwischen meine Mutter und mich drängte. Nur ein einziges Mal hatte Mutter mir Grund zur Sorge gegeben. Als ich so um die Zwanzig war, hatte ein Witwer, ein gewisser „Sandnes“, es für gut befunden, ab und zu vorbeizuschauen. Ich hatte sofort begriffen, daß die Lage ernst war, und mir eine knallharte Konfrontationstaktik zurechtgelegt. Jedesmal wenn er kam, stellte ich mich mitten ins Zimmer und starrte ihn an. Bis er ging. Mutters Weinen und Flehen traf auf taube Ohren. Ich rührte mich nicht vom Fleck und konnte meinen Blick über eine Stunde durchhalten. Nach zwei Monaten war die Sache gegessen, und Mutter erwähnte ihn mit keinem Wort mehr.
(Ententanz, S. 212)
Mein Leben lang hatte ich mit einer Mutter von schwachem und vagem Charakter zusammengelebt. Ich hatte den Rahmen um unser gemeinsames Dasein erhalten und verhindern müssen, daß alles zur Sinnlosigkeit zerfloß. In all den Jahren hatte ich die Ideen vertreten müssen, die familiäre Ideologie gewissermaßen, während Mutter sich auf ihre schlichte Weise um das Praktische gekümmert hatte. Ich hatte mich daran gewöhnt, ihr aus der weichen Tiefe des Sessels zuzusehen, wenn sie sich um die Topfblumen kümmerte, den Boden putzte oder in meinem Zimmer die Bettwäsche wechselte. Ans Waschbecken gelehnt, hatte ich die Tricks studiert, mit denen sie Frikadellen und Weißkohl, geräucherten Köhler und Königskuchen zubereitete. Als Sozialdemokrat hatte ich immer tiefen Respekt vor der manuellen Arbeit empfunden, vor dem wirklichen Tagewerk. Ich erkannte die Grenzen, ja, die Unbeholfenheit des Intellektuellen, wenn es um Praktisches ging. Und eben deshalb mußte ich Mutter klarmachen, wo zwischen uns die Grenze verlief. Es war nicht egal, wer von uns das Klo putzte. Wenn ich solche Arbeiten verweigerte, faßte sie das oft als Zeichen von Faulheit oder Unwillen meinerseits auf. Aber ich wußte, wenn ich die Ärmel hochkrempelte und ihr zu Willen war, dann würde ich zugleich in ihren geheimen Raum eindringen. Sie ahnte nicht einmal, daß dieser geheime Raum existierte, so geheim war der nämlich, aber ich sah es doch von meinem Sessel aus kristallklar. Mein ruhiges „nein, Mutter“ provozierte sie zwar manchmal, aber in den letzten Jahren ihres Lebens hatte sich wohl zumindest ihr Unterbewußtsein mit dem Stand der Dinge abgefunden. Sie schien sich auf irgendeine Weise damit ausgesöhnt zu haben, daß unsere Arbeitsteilung nun einmal so und nicht anders aussah. Aber jetzt, nach Mutters Tod, war dieses System zusammengebrochen. Innerhalb weniger kurzer Wochen war ich in eine Anarchie gestürzt worden, in der zu allen Tageszeiten Fremde meine Wege kreuzten. Die äußere Ruhe um mein Dasein in einer Blockwohnung am Rande der Landeshauptstadt war jählings einem aufgezwungenen Zimmergenossen und dem Zwang zu sozialem Umgang mit Menschen gewichen, die im Grunde restlos asozial waren.
(Ausblick auf das Paradies, S. 45f.)

Elling über Frauen
Ich wußte überhaupt nicht viel über Küsse. Ich hatte nicht mitmachen wollen, als meine Klassenkameraden damals wie die Wilden experimentierten. Meine Zunge in einen fremden Mund pressen. Was in aller Welt hatte ich dort zu suchen? Ganz zu schweigen von der Vorstellung, eine fremde Zunge zu Besuch zu haben! Einen klitschnassen Fleischklumpen voller Bakterien und Dreck. Was, wenn sie ganz andere Essensgewohnheiten hatte als ich? Was, wenn ihr Lieblingsessen Schwarzbrot mit einer dicken Schicht altem Käse war? Was, wenn sie Hering liebte? Die Zunge, die jetzt so wollüstig in deinem Mund rotiert, ist daran gewöhnt, in feingekautem saurem Hering mit rohen Zwiebeln zu schwelgen. Oder in noch Schlimmerem. Nein. Ich hatte auf höfliche Weise abgelehnt. Zweimal war ich gefragt worden, aber ich hatte abgelehnt.
(Ausblick auf das Paradies, S. 43)
Um es ganz offen zu sagen: Ich war niemals nackt mit einer Frau zusammen gewesen, ... Das ist wirklich mein wunder Punkt. Mein Glied hat nämlich einen kleinen Knick. Die untere Hälfte zeigt leicht nach links. Dem Glied fehlt überhaupt nichts. Ich pisse wie ein Wasserfall, und der Knick behindert meine Potenz, was immer ich damit anfangen soll, keineswegs. Nein, es ist ganz einfach ein harmloser Knick. Aber harmlos oder nicht – Kinder sind grausam. Rücksichtslos. Es war überhaupt kein Spaß, nach der Turnstunde duschen zu müssen. Neun Jahre in der Schule hatten mir überhaupt beigebracht, daß es sich nicht lohnte, irgendwem zu vertrauen.
(Ausblick auf das Paradies, S. 138)
Ich wußte überhaupt nicht viel über Küsse. Ich hatte nicht mitmachen wollen, als meine Klassenkameraden damals wie die Wilden experimentierten. Meine Zunge in einen fremden Mund pressen. Was in aller Welt hatte ich dort zu suchen? Ganz zu schweigen von der Vorstellung, eine fremde Zunge zu Besuch zu haben! Einen klitschnassen Fleischklumpen voller Bakterien und Dreck. Was, wenn sie ganz andere Essensgewohnheiten hatte als ich? Was, wenn ihr Lieblingsessen Schwarzbrot mit einer dicken Schicht altem Käse war? Was, wenn sie Hering liebte? Die Zunge, die jetzt so wollüstig in deinem Mund rotiert, ist daran gewöhnt, in feingekautem saurem Hering mit rohen Zwiebeln zu schwelgen. Oder in noch Schlimmerem. Nein. Ich hatte auf höfliche Weise abgelehnt. Zweimal war ich gefragt worden, aber ich hatte abgelehnt.
(Ausblick auf das Paradies, S. 43)
Um es ganz offen zu sagen: Ich war niemals nackt mit einer Frau zusammen gewesen, ... Das ist wirklich mein wunder Punkt. Mein Glied hat nämlich einen kleinen Knick. Die untere Hälfte zeigt leicht nach links. Dem Glied fehlt überhaupt nichts. Ich pisse wie ein Wasserfall, und der Knick behindert meine Potenz, was immer ich damit anfangen soll, keineswegs. Nein, es ist ganz einfach ein harmloser Knick. Aber harmlos oder nicht – Kinder sind grausam. Rücksichtslos. Es war überhaupt kein Spaß, nach der Turnstunde duschen zu müssen. Neun Jahre in der Schule hatten mir überhaupt beigebracht, daß es sich nicht lohnte, irgendwem zu vertrauen.
(Ausblick auf das Paradies, S. 138)

Elling über Gro Harlem Brundtland
Ich ... bin Sammler. Als Kind habe ich Briefmarken und Münzen, Kronkorken und Vogeleier gesammelt. Als junger Mann fing ich an, Gro Harlem Brundtland zu sammeln. Ich kenne ihren Lebenslauf in- und auswendig, aber mich interessieren die Berichte über ihre Person und die politischen Informationen nicht. Was ich sammle und sorgfältig aus Zeitungen und Zeitschriften ausschneide, sind Bilder von ihr, Gros Miene, ihre Haltung. Ich habe Gro in jeder Art von Wind und Wetter, ich habe sie im politischen Sturm des Parlaments und im wilden Wind Finnmarks. Ich habe Gro in Rio, ich habe Gro in Wien und in Odda. Ich habe Gro in Bluse und Rock, in Freizeithose und Pullover, ich habe sie im Ballkleid und in samischer Tracht. Und ich habe sie im Gummianzug. Auf dem Surfbrett. Gro in herausfordernder Positur, während sie das Gewicht ihres Körpers quer vor den Wind legt – hier stellt sie das Symbol ihrer selbst dar. Sie ist die Frau gegen den Wind, die Frau, die sich dort am wohlsten fühlt, wo der Sturm am wildesten tobt. Ich weiß nicht mehr so recht, woher ich das Bild habe, ich glaube, es war irgendwann in den achtziger Jahren im Dagbladet. Ich habe es aus praktischen Gründen in Plastikfolie eingeschweißt. Gro Harlem Brundtlands kräftige Hinterpartie, verhüllt nur von einer dünnen Gummihaut, ist ein Anblick, der an die rechte Hand eines alleinstehenden Mannes appelliert. Übrigens berühre ich mich nicht allzu oft auf diese Weise. Es gibt mir das Gefühl zu verschwenden, etwas von mir selbst wegzuwerfen. Und ich war immer ein vorsichtiger Junge. Genügsam. Ich kaufe nicht Bjellands Makrelen in Tomate, wenn eine andere Sorte fünfzig Öre billiger ist. Makrele in Tomate ist Makrele in Tomate. Früher habe ich geraucht. Damit habe ich aufgehört. Als junger Mann habe ich am Wochenende manchmal getrunken. Jetzt trinke ich manchmal zu Silvester. Ich kaufe neues Brot, wenn das alte aufgegessen ist, nicht, wenn das alte trocken ist. Ich komme gut zurecht mit meiner Rente.
(Ausblick auf das Paradies, S. 11f.)
Ich ... bin Sammler. Als Kind habe ich Briefmarken und Münzen, Kronkorken und Vogeleier gesammelt. Als junger Mann fing ich an, Gro Harlem Brundtland zu sammeln. Ich kenne ihren Lebenslauf in- und auswendig, aber mich interessieren die Berichte über ihre Person und die politischen Informationen nicht. Was ich sammle und sorgfältig aus Zeitungen und Zeitschriften ausschneide, sind Bilder von ihr, Gros Miene, ihre Haltung. Ich habe Gro in jeder Art von Wind und Wetter, ich habe sie im politischen Sturm des Parlaments und im wilden Wind Finnmarks. Ich habe Gro in Rio, ich habe Gro in Wien und in Odda. Ich habe Gro in Bluse und Rock, in Freizeithose und Pullover, ich habe sie im Ballkleid und in samischer Tracht. Und ich habe sie im Gummianzug. Auf dem Surfbrett. Gro in herausfordernder Positur, während sie das Gewicht ihres Körpers quer vor den Wind legt – hier stellt sie das Symbol ihrer selbst dar. Sie ist die Frau gegen den Wind, die Frau, die sich dort am wohlsten fühlt, wo der Sturm am wildesten tobt. Ich weiß nicht mehr so recht, woher ich das Bild habe, ich glaube, es war irgendwann in den achtziger Jahren im Dagbladet. Ich habe es aus praktischen Gründen in Plastikfolie eingeschweißt. Gro Harlem Brundtlands kräftige Hinterpartie, verhüllt nur von einer dünnen Gummihaut, ist ein Anblick, der an die rechte Hand eines alleinstehenden Mannes appelliert. Übrigens berühre ich mich nicht allzu oft auf diese Weise. Es gibt mir das Gefühl zu verschwenden, etwas von mir selbst wegzuwerfen. Und ich war immer ein vorsichtiger Junge. Genügsam. Ich kaufe nicht Bjellands Makrelen in Tomate, wenn eine andere Sorte fünfzig Öre billiger ist. Makrele in Tomate ist Makrele in Tomate. Früher habe ich geraucht. Damit habe ich aufgehört. Als junger Mann habe ich am Wochenende manchmal getrunken. Jetzt trinke ich manchmal zu Silvester. Ich kaufe neues Brot, wenn das alte aufgegessen ist, nicht, wenn das alte trocken ist. Ich komme gut zurecht mit meiner Rente.
(Ausblick auf das Paradies, S. 11f.)

Elling über Zwangsneurosen
Ich wusch mich gründlich. Vorne und hinten, oben und unten. Wieder tauchte das Bild einer vergewaltigten Frau auf. Als ich fertig war und mich ganz und gar in frischgewaschene Kleider geworfen hatte, überkam mich erneut die Unruhe. Etwas schien in der Luft zu liegen. Hatte ich mich gründlich genug gewaschen? Hatten Seife und Waschlappen jeden Millimeter meines Körpers berührt, oder gab es Stellen, die ich „vergessen“ hatte? Ich zog mich wieder aus. Stellte das heiße Wasser an. Nahm jetzt Mutters Bürste. Schrubbte mich hellrot. Drehte das heiße Wasser bis an die Grenze des Erträglichen auf. Über die Grenze des Erträglichen hinaus, ich schrie. Dann kaltes Wasser. Eiskalt, wieder schrie ich. Dann die Bürste und ein ganz neues Stück Seife. Es war gute Seife, das merkte ich sofort. Sie schäumte ordentlich und duftete ganz wunderbar. Heiß. Kalt. Heiß. Kalt. Ich stieg aus der Badewanne und rieb mich lange mit einem hundertprozentig sauberen Handtuch ab. Reichte das? War ich jetzt sauber? Ich stieg wieder in die Wanne. Drehte das heiße Wasser auf. ... Trotzdem war ich nicht dumm genug, um nicht zu wissen, daß ich im Badezimmer soeben die pure Zwangshandlung vollzogen hatte. Das ist lange nicht mehr vorgekommen, Elling. Weißt du noch, wie du fast eine ganze Woche lang immer auf der untersten Treppenstufe kehrtmachen und wieder nach oben gehen mußtest, weil du nicht sicher warst, ob deine Füße; beide Füße, jede Treppenstufe zwischen den Stockwerken berührt hatten? Gut, daß du über Selbstironie verfügst, Elling. Sonst könntest du dich selbst leicht zum Wahnsinn treiben.
(Ausblick auf das Paradies, S. 165ff.)
Ich wusch mich gründlich. Vorne und hinten, oben und unten. Wieder tauchte das Bild einer vergewaltigten Frau auf. Als ich fertig war und mich ganz und gar in frischgewaschene Kleider geworfen hatte, überkam mich erneut die Unruhe. Etwas schien in der Luft zu liegen. Hatte ich mich gründlich genug gewaschen? Hatten Seife und Waschlappen jeden Millimeter meines Körpers berührt, oder gab es Stellen, die ich „vergessen“ hatte? Ich zog mich wieder aus. Stellte das heiße Wasser an. Nahm jetzt Mutters Bürste. Schrubbte mich hellrot. Drehte das heiße Wasser bis an die Grenze des Erträglichen auf. Über die Grenze des Erträglichen hinaus, ich schrie. Dann kaltes Wasser. Eiskalt, wieder schrie ich. Dann die Bürste und ein ganz neues Stück Seife. Es war gute Seife, das merkte ich sofort. Sie schäumte ordentlich und duftete ganz wunderbar. Heiß. Kalt. Heiß. Kalt. Ich stieg aus der Badewanne und rieb mich lange mit einem hundertprozentig sauberen Handtuch ab. Reichte das? War ich jetzt sauber? Ich stieg wieder in die Wanne. Drehte das heiße Wasser auf. ... Trotzdem war ich nicht dumm genug, um nicht zu wissen, daß ich im Badezimmer soeben die pure Zwangshandlung vollzogen hatte. Das ist lange nicht mehr vorgekommen, Elling. Weißt du noch, wie du fast eine ganze Woche lang immer auf der untersten Treppenstufe kehrtmachen und wieder nach oben gehen mußtest, weil du nicht sicher warst, ob deine Füße; beide Füße, jede Treppenstufe zwischen den Stockwerken berührt hatten? Gut, daß du über Selbstironie verfügst, Elling. Sonst könntest du dich selbst leicht zum Wahnsinn treiben.
(Ausblick auf das Paradies, S. 165ff.)

Elling über Zwangsneurosen
Ich wusch mich gründlich. Vorne und hinten, oben und unten. Wieder tauchte das Bild einer vergewaltigten Frau auf. Als ich fertig war und mich ganz und gar in frischgewaschene Kleider geworfen hatte, überkam mich erneut die Unruhe. Etwas schien in der Luft zu liegen. Hatte ich mich gründlich genug gewaschen? Hatten Seife und Waschlappen jeden Millimeter meines Körpers berührt, oder gab es Stellen, die ich „vergessen“ hatte? Ich zog mich wieder aus. Stellte das heiße Wasser an. Nahm jetzt Mutters Bürste. Schrubbte mich hellrot. Drehte das heiße Wasser bis an die Grenze des Erträglichen auf. Über die Grenze des Erträglichen hinaus, ich schrie. Dann kaltes Wasser. Eiskalt, wieder schrie ich. Dann die Bürste und ein ganz neues Stück Seife. Es war gute Seife, das merkte ich sofort. Sie schäumte ordentlich und duftete ganz wunderbar. Heiß. Kalt. Heiß. Kalt. Ich stieg aus der Badewanne und rieb mich lange mit einem hundertprozentig sauberen Handtuch ab. Reichte das? War ich jetzt sauber? Ich stieg wieder in die Wanne. Drehte das heiße Wasser auf. ... Trotzdem war ich nicht dumm genug, um nicht zu wissen, daß ich im Badezimmer soeben die pure Zwangshandlung vollzogen hatte. Das ist lange nicht mehr vorgekommen, Elling. Weißt du noch, wie du fast eine ganze Woche lang immer auf der untersten Treppenstufe kehrtmachen und wieder nach oben gehen mußtest, weil du nicht sicher warst, ob deine Füße; beide Füße, jede Treppenstufe zwischen den Stockwerken berührt hatten? Gut, daß du über Selbstironie verfügst, Elling. Sonst könntest du dich selbst leicht zum Wahnsinn treiben.
(Ausblick auf das Paradies, S. 165ff.)
Ich wusch mich gründlich. Vorne und hinten, oben und unten. Wieder tauchte das Bild einer vergewaltigten Frau auf. Als ich fertig war und mich ganz und gar in frischgewaschene Kleider geworfen hatte, überkam mich erneut die Unruhe. Etwas schien in der Luft zu liegen. Hatte ich mich gründlich genug gewaschen? Hatten Seife und Waschlappen jeden Millimeter meines Körpers berührt, oder gab es Stellen, die ich „vergessen“ hatte? Ich zog mich wieder aus. Stellte das heiße Wasser an. Nahm jetzt Mutters Bürste. Schrubbte mich hellrot. Drehte das heiße Wasser bis an die Grenze des Erträglichen auf. Über die Grenze des Erträglichen hinaus, ich schrie. Dann kaltes Wasser. Eiskalt, wieder schrie ich. Dann die Bürste und ein ganz neues Stück Seife. Es war gute Seife, das merkte ich sofort. Sie schäumte ordentlich und duftete ganz wunderbar. Heiß. Kalt. Heiß. Kalt. Ich stieg aus der Badewanne und rieb mich lange mit einem hundertprozentig sauberen Handtuch ab. Reichte das? War ich jetzt sauber? Ich stieg wieder in die Wanne. Drehte das heiße Wasser auf. ... Trotzdem war ich nicht dumm genug, um nicht zu wissen, daß ich im Badezimmer soeben die pure Zwangshandlung vollzogen hatte. Das ist lange nicht mehr vorgekommen, Elling. Weißt du noch, wie du fast eine ganze Woche lang immer auf der untersten Treppenstufe kehrtmachen und wieder nach oben gehen mußtest, weil du nicht sicher warst, ob deine Füße; beide Füße, jede Treppenstufe zwischen den Stockwerken berührt hatten? Gut, daß du über Selbstironie verfügst, Elling. Sonst könntest du dich selbst leicht zum Wahnsinn treiben.
(Ausblick auf das Paradies, S. 165ff.)

Elling über Telefone
Mutter hatte das Telefon benutzt. Nicht oft, aber sie hatte es benutzt. Sie hatte ja hier und dort Bekannte gehabt, und da ihr Sinn für Geselligkeit nicht sehr ausgeprägt gewesen war, hatte der Kontakt mit ihnen vorwiegend durch den grauen Apparat stattgefunden. Ich selbst hatte mich für die Erfindung des alten Bell nie besonders erwärmen können. Derjenige, der hier den richtigen Zifferncode gewählt hatte, hatte sich in seinem Inneren bereits ein Bild von mir gemacht. Wenn man erst einmal den Hörer abgenommen und das einleitende „Hallo“ gesagt hatte, dann hatte man sich damit bloßgestellt. Man war auf Gedeih und Verderb mit seinem Namen verbunden. Hier ist Elling, und Elling sitzt jetzt an Ort und Stelle im Block. Mit anderen Worten: Elling ist da, wo er hingehört. Ich will ja nicht behaupten, daß dieses Eingeständnis nicht zutreffend gewesen wäre, aber ich konnte nicht sicher sein, inwieweit dieses Geständnis außer mir noch anderen anvertraut werden sollte. Ging es andere etwas an, ob ich zu Hause war oder vielleicht gerade einen kleinen Spaziergang ins Einkaufszentrum machte? Im Grunde nicht. Ich war auch schon zweimal falsch angerufen worden. Ein äußerst zweifelhaftes Erlebnis. Zuerst der Zweifel bei dem Anruf überhaupt. Soll ich hingehen, oder soll ich es lassen? Schweißnasse Handflächen. Runden durchs Zimmer. Dann trägt die Entschlossenheit den Sieg davon. Man nimmt den Hörer ab und sagt höflich hallo. Ob das Ole sei? Nein, hier ist nicht Ole. Hier ist Elling, und Mutter ist einkaufen gegangen. Ich weiß nicht, wer schlimmer ist. Die, die einfach in einer Geste von geballter Unhöflichkeit den Hörer auf die Gabel knallen, oder die, die kriecherisch um Entschuldigung bitten. Die Sache ist nämlich die, daß mich beide in einem Zustand der Unsicherheit zurücklassen. Denn stand es wirklich fest, daß diese fremde Stimme mit Ole hatte sprechen wollen? War es nicht eher so, daß der Anrufer sich davon hatte überzeugen wollen, daß ein gewisser Elling zu Hause war? Nach solchen Anrufen stand ich lange am Fenster und beobachtete genau, was sich unten, auf Bodenniveau, so tat. ... Das Telefonklingeln ist schon schlimm. Aber das Geräusch der Türklingel ist tausendmal schlimmer. „Ein freundliches Dingdong“ hatte Mutter dieses Geräusch genannt. Ja danke! Ich wüßte wirklich gern, was an diesem Dingdong so freundlich sein sollte. Bedrohlich war es. Wie das Geräusch der Glocken in einer Friedhofskapelle. ... Wieder schellte es. Diesmal hitziger. Ich schrie lautlos auf und preßte mir die Handflächen auf die Ohren. Ein gewaltiger Druck entstand, einen Moment lang fürchtete ich, mein Trommelfell könnte von innen her gesprengt werden oder meine Augen aus dem Kopf quellen. Voller Galgenhumor, wie ich schließlich bin, sah ich vor mir, wie meine Augäpfel durchs Zimmer schossen und mit unisonem Klatschen den Spiegel über dem Waschbecken trafen.
(Ausblick auf das Paradies, S. 161f. und 170)
Mutter hatte das Telefon benutzt. Nicht oft, aber sie hatte es benutzt. Sie hatte ja hier und dort Bekannte gehabt, und da ihr Sinn für Geselligkeit nicht sehr ausgeprägt gewesen war, hatte der Kontakt mit ihnen vorwiegend durch den grauen Apparat stattgefunden. Ich selbst hatte mich für die Erfindung des alten Bell nie besonders erwärmen können. Derjenige, der hier den richtigen Zifferncode gewählt hatte, hatte sich in seinem Inneren bereits ein Bild von mir gemacht. Wenn man erst einmal den Hörer abgenommen und das einleitende „Hallo“ gesagt hatte, dann hatte man sich damit bloßgestellt. Man war auf Gedeih und Verderb mit seinem Namen verbunden. Hier ist Elling, und Elling sitzt jetzt an Ort und Stelle im Block. Mit anderen Worten: Elling ist da, wo er hingehört. Ich will ja nicht behaupten, daß dieses Eingeständnis nicht zutreffend gewesen wäre, aber ich konnte nicht sicher sein, inwieweit dieses Geständnis außer mir noch anderen anvertraut werden sollte. Ging es andere etwas an, ob ich zu Hause war oder vielleicht gerade einen kleinen Spaziergang ins Einkaufszentrum machte? Im Grunde nicht. Ich war auch schon zweimal falsch angerufen worden. Ein äußerst zweifelhaftes Erlebnis. Zuerst der Zweifel bei dem Anruf überhaupt. Soll ich hingehen, oder soll ich es lassen? Schweißnasse Handflächen. Runden durchs Zimmer. Dann trägt die Entschlossenheit den Sieg davon. Man nimmt den Hörer ab und sagt höflich hallo. Ob das Ole sei? Nein, hier ist nicht Ole. Hier ist Elling, und Mutter ist einkaufen gegangen. Ich weiß nicht, wer schlimmer ist. Die, die einfach in einer Geste von geballter Unhöflichkeit den Hörer auf die Gabel knallen, oder die, die kriecherisch um Entschuldigung bitten. Die Sache ist nämlich die, daß mich beide in einem Zustand der Unsicherheit zurücklassen. Denn stand es wirklich fest, daß diese fremde Stimme mit Ole hatte sprechen wollen? War es nicht eher so, daß der Anrufer sich davon hatte überzeugen wollen, daß ein gewisser Elling zu Hause war? Nach solchen Anrufen stand ich lange am Fenster und beobachtete genau, was sich unten, auf Bodenniveau, so tat. ... Das Telefonklingeln ist schon schlimm. Aber das Geräusch der Türklingel ist tausendmal schlimmer. „Ein freundliches Dingdong“ hatte Mutter dieses Geräusch genannt. Ja danke! Ich wüßte wirklich gern, was an diesem Dingdong so freundlich sein sollte. Bedrohlich war es. Wie das Geräusch der Glocken in einer Friedhofskapelle. ... Wieder schellte es. Diesmal hitziger. Ich schrie lautlos auf und preßte mir die Handflächen auf die Ohren. Ein gewaltiger Druck entstand, einen Moment lang fürchtete ich, mein Trommelfell könnte von innen her gesprengt werden oder meine Augen aus dem Kopf quellen. Voller Galgenhumor, wie ich schließlich bin, sah ich vor mir, wie meine Augäpfel durchs Zimmer schossen und mit unisonem Klatschen den Spiegel über dem Waschbecken trafen.
(Ausblick auf das Paradies, S. 161f. und 170)

Darsteller und Darstellerinnen | |
|---|---|
| Elling | Udo Schneider |
| Kjell Bjarne | Gerhard Kähling |
| Frank Ǻsli / Kellner | Roland Möser |
| Gunn / Kellnerin / Reidun Nordsletten | Renate Pick |
Inszenierungsteam | |
| Regie | Olaf Hilliger |
| Ausstattung | |
| Dramaturgie / Regieassistenz | Sandra Pagel |
| Toncollagen | |
| Inspizienz | |
| Soufflage |
Stand vom 09.09.2004





 Uckermärkische Bühnen Schwedt
Uckermärkische Bühnen Schwedt